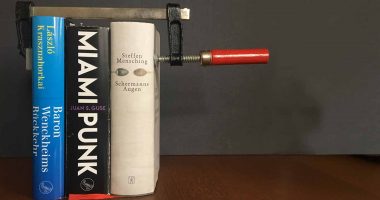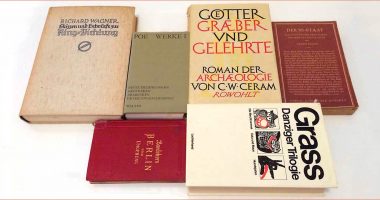Ausweitung der Kampfzone – Eine Relektüre
Vor 20 Jahren ist Michel Houellebecq mit seinem Romandebüt auf die literarische Bühne getreten. Vier Jahre später, 1999, lag die deutsche Übersetzung vor. Seitdem gilt Houellebecq als wichtige Stimme der französchen, der europäischen Literatur. Zeit für eine Relektüre des schmalen Bändchens. Was macht die Ausweitung der Kampfzone mit dem Leser von heute?

Der erste Eindruck: der Text ist nach wie vor packend. Ein Roman, getragen von lakonischer Verzweiflung und zynischer Lamoryanz. Über allem schwingt ein dumpfer Oberton: es ist unmöglich, sein Leben frei bestimmt und unbeschwert zu leben; knapp zusammengefasst im letzten Satz.
Das Lebensziel ist verfehlt; es ist zwei Uhr nachmittags.
Kurz zum Inhalt: Ausweitung der Kampfzone ist geschrieben aus der Sicht eines etwa dreißichjährigen namenlosen Ich-Erzählers; ein Pariser Informatiker, der auf eine Dienstreise im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums geschickt wird. Der Erzähler versinkt dabei langsam aber sicher in tiefe Depression, äußert bald nur noch gnadenlose Kultur- und Konsumkritik, Schuldzuweisungen und grenzenloses Selbstmitleid. Höhepunkt dieses Krankseins an der Gesellschaft ist der Versuch, seinen Arbeitskollegen zum Sexualmord anzustiften, der aber letztlich nur in eine Selbsttötung mündet. Der Erzähler verliert wenig später seinen Job und begibt sich in eine psychatrische Klinik. Zuletzt hofft er auf mystische Erlösung inmitten der Natur; vergebens.
Beim Publikum stieß der Roman von Michel Houellebecq zunächst auf mäßiges Interesse, doch (einige) Kritiker erklärten ihn zum Skandalon und füllten das Feuilleton mit kontroversen Diskussionen. Hat all das 20 Jahre später noch Bestand? Notizen zu einer (lohnenden) Relektüre.
Zurück in La Roche-sur-Yon, kaufte ich ein Filetmesser im Supermarkt; ich begann, die Umrisse eines Plans zu sehen.
Der Icherzähler stachelt seinen (nicht nur sexuell) frustrierten Arbeitskollegen an, mäßige Erfolge bei Frauen (und im Leben allgemein) mit Lustmorden zu kompensieren.
Noch heute Abend sollst du die Laufbahn des Mörders betreten; glaub mir, mein Freund, das ist die einzige Chance, die dir bleibt. Wenn du diese Frauen vor der Spitze deines Messers zittern und um ihre Jugend flehen siehst, wirst du wahrhaftig ihr Herr und Meister sein; du wirst ihren Leib und ihre Seele besitzen.
Insbesondere diese Propaganda für den Sexualmord war ein Anlass für die scharfe Kritik an Houellebecq; das sei billige, berechnende Provokation, so der Vorwurf. Doch das greift eindeutig zu kurz: denn im Kontext des Textes ist diese Haltung konsequent. Zu leben heißt für den Erzähler, sich den Vorschriften zu fügen, die gesellschaftlichen Spielregeln zu akzeptieren. Wer das nicht mehr kann und will, sei es aus Frust oder mit positiv gerichtetem Willen, muss in die Kampfzone eindringen, sich widersetzen und in letzter Konsequenz das Kampfgebiet stetig ausweiten. Der größte, eigentlich der einzige Feind bei diesem Kampf ist der Neoliberalismus, dieses „Lasst-alle-machen-was-sie-wollen-es-wird-schon-irgendwie-gut-gehen“. Erstrebenswert für die einen (unglaublich, nicht wahr?!), für Houellebecq jedoch das Dauerübel schlechthin.
In einem völlig liberalen Wirtschaftssystem häufen einige wenige beträchtliche Reichtümer an; andere verkommen in der Arbeitslosigkeit und im Elend. In einem völlig liberalen Sexualsystem haben einige ein abwechslungsreiches und erregendes Sexualleben; andere sind auf Masturbation und Einsamkeit beschränkt. Der Wirtschaftsliberalismus ist die erweiterte Kampfzone, das heißt, er gilt für alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. Ebenso bedeutet der sexuelle Liberalismus die Ausweitung der Kampfzone, ihre Ausdehnung auf alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen.
Man mag sich stoßen (und viele tun das auch) an der expliziten Sexualität in Hoeullebecqs Text(en), an der Triebkraft, die der Sexus für ihn hat als Movens für das Leben an sich und sich stoßen auch daran, wie er echte Liebe und Zufriedenheit als schlicht unmöglich postuliert. Houellebecq bevorzugt den extremen Blickwinkel, der gewöhnlich selten eingenommen wird. Unter diesem Blickwinkel jedoch ist seine Sicht auf die Welt, die Analyse der Kampfzone Gesellschaft, wie oben beschrieben, einfach nur realistisch und ehrlich.
Das alles wird transportiert in einer eigenwillig dichten Sprache mit enormer Sogwirkung. Besonders fasziniert haben mich (damals wie heute) die unterschiedlichen Tonhöhen, mit denen Hoeullebecq (bzw. sein Erzähler) spielt: da ist einerseits diese narrative Nüchternheit, ein Stil der klaren, kalten, wissenschaftlichen Beschreibung. Dahinein schlägt das, was der Literaturwissenschaftler Thomas Hübener als „arabeske Hysterie“ bezeichnet, etwas, das an den Dichter Lautréamont erinnere. Das stimmt.
Ist dieser Roman mit seiner existentiellen Kapitalismuskritik 2.0 immer noch aktuell oder schon wieder? Beides, denke ich. Die jüngsten Börsen- und Bankencrashs und das daraus resultierende „Weiterzocken-als-wäre-nichts-gewesen“ konnte Houellebecq vor 20 Jahren allenfalls ahnen. Aber in gewisser Weise gibt ihm heute die reale Kampfzone mehr Recht denn je.
Die Erzählhaltung in Ausweitung der Kampfzone ist eine zutiefst frustrierte und pessimistische. Darauf muss sich der Leser einlassen. Er kann zustimmen oder vehement ablehnen, aber in jedem Fall ist er gezwungen, (s)eine Stellung zu beziehen. Das gilt übrigens für alle Romane Houellebecqs. Und gerade das macht ihn für mich zu einer starken und provokativen Stimme der Literatur.
 Michel Houellebecq – Ausweitung der Kampfzone
Michel Houellebecq – Ausweitung der KampfzoneAus dem Französischen von Leopold Federmair
Broschiert, 176 Seiten
Berlin: Wagenbach 2012 (Wagenbach Taschenbuch 689)
ISBN 978-3-8031-2689-4
Ich weiß, Houellebecq polarisiert. – Lust auf Widerspruch, Zustimmung, Ergänzung? – Frei heraus damit!