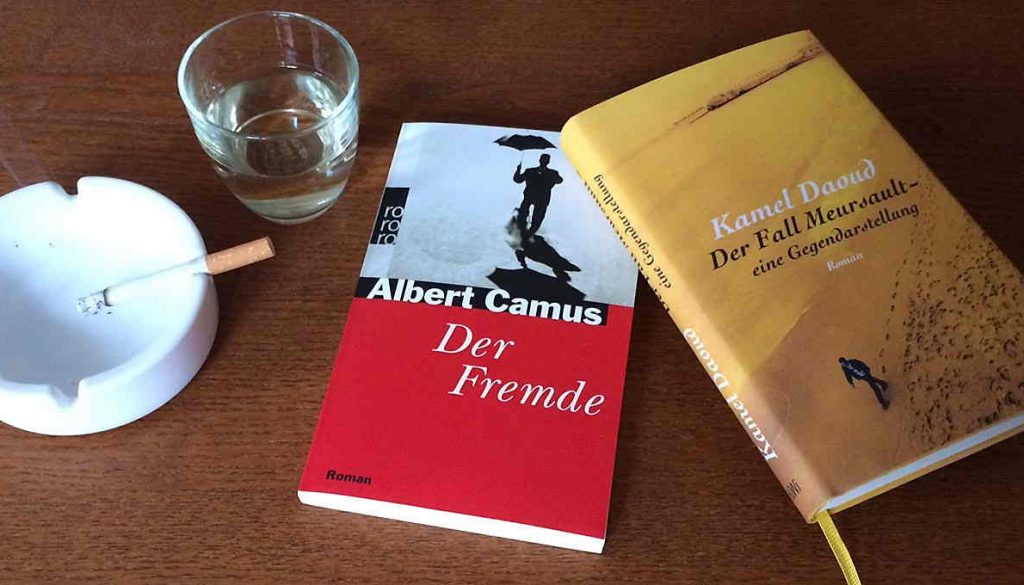Der lange Schatten des Fremden – Ein Kneipengespräch
Ein berühmter Autor hat den Tod eines Arabers erzählt und daraus ein bewegendes Buch gemacht – »wie eine Sonne in einer Schachtel«.
Ein Kneipentisch, irgendwo. Auf dem Tisch zwei Bücher. Das des berühmten Franzosen und ein anderes. Dazu Wein, Tabak und ein Gespräch:
– Albert Camus. Der Fremde. Ein Buch wie ein Sonnenstich. Wuchtig, klar, ernüchternd. Dieser Meursault treibt mich in Wut. »Unternimm etwas, gib die Gleichgültigkeit auf, verhalte dich«, rufe ich ihm zu. Aber er hört nicht, tut nichts. Meursault, die Urfigur der Existentialisten, ein Mann gefangen im Dickicht des Alltags, getrandet am Nullpunkt des Absurden, dem er nichts mehr entgegenzusetzen hat. Kain und Abel in einer Person. Ich sollte es nochmal lesen, ist lange her. Aber was liegt daneben? Der Fall Meursault – Eine Gegendarstellung. Das kenne ich noch nicht. Neu?
– Ja. Der Erzähler heißt Haroun. Er sitzt jeden Abend in einer Bar in Oman, der Geburtsort Camus übrigens. Haroun hatte einen Bruder, Moussa, Moses, hieß der. Aber ein Franzose hat ihn vor vielen Jahren erschossen. Warum hat der Franzose nie verraten, nur so viel, die Sonne habe ihn geblendet. Seitdem lebt Haroun im Schatten dieses Fremden. Als ein junger Literaturwissenschaftler in die Bar kommt, das berühmte Buch auf den Tisch legt, so wie ich hier, sieht Haroun seine Chance gekommen. In einer weinseligen Suada spult er seine Lebensbeichte ab. Seine Gegendarstellung.
– Kamel Daoud?! Ein Araber, nehme ich an.
– Ja aus Algerien, eigentlich Journalist, aber er hat vor Der Fall Meursault schon einen kleinen Erzählungsband veröffentlicht. Das hier ist sein erster Roman, eigentlich kein wirklicher Roman, eher ein Monolog, eine Abrechnung. Daoud läßt seinen Erzähler mit seiner Heimat Algerien ins Gericht gehen, mit den französischen Kolonialherren und seiner Mutter. Camus ist nur eine Folie, der Anlass.
– Geschicktes Marketing, wie?! Man nehme einen Klassiker der Weltliteratur und schlachte ihn nach eigenem Bedarf aus. Der Name Camus zieht und der Erfolg ist garantiert.
– Erfolg hat er, ja, vor allem in Frankreich und Algerien, und nicht ausschließlich, weil er unseren Camus ausschlachtet. Die einen bescheinigem ihm eine brilliante Sicht auf die Verhältnisse in Algerien, auf die fatalen Folgen jahrzehntelanger Unterdrückung, die anderen kritisieren ihn, weil er beide Länder in den Schmutz zerre und die Religion, vor allem den Islam. Es stimmt beides. Und Camus Der Fremde ist weit mehr als nur ein bequemer Aufhänger. Daoud nutzt Camus Roman als Folie und Projektionsfläche, spielt geschickt mit der Fiktion der Fiktion in der Fiktion, er zitiert und paraphrasiert genüßlich, greift Motive des Vorgängers auf und mainipuliert sie versiert, die Sonne zum Beispiel ist auch bei ihm unerbittlich, grell und gnadenlos, und sie treibt seinen Erzähler Haroun in eine ähnlich indifferente Tatenlosigkei wie Camus seinen Helden. Haroun ist vaterlos, sein Leben war bis zur Unabhängigkeit Algeriens eines im Schatten des toten Bruders, die Mutter hatte ihr ganzes Sein nur an den toten Sohn fixiert, an das leere Grab, denn der Leichnam wurde ja nie gefunden, an den Glauben, irgendwann Gewissheit zu bekommen. Der lebende Sohn lief im überlangen Schatten des Toten, des vermeintlichen Märtyrers nur nebenher.
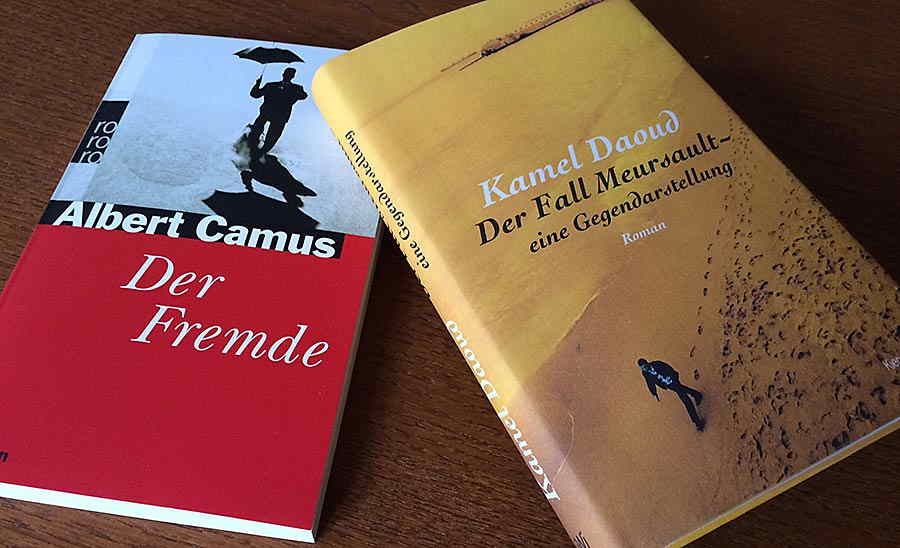
– Haroun steht also der Welt genauso fremd und haltlos gegenüber wie Meursault? Nur eben von der anderen Seite her, von der arabischen?
– Ja, bis auch er einen Menschen erschießt, einen Franzosen, ebenso ohne wirklichen Grund. Er feuert die gleiche Anzahl Kugeln ab wie Meursault auf den Araber am Strand. Zur gleichen Uhrzeit. Auch er wird verurteilt, aber nicht wegen der Tat an sich, sondern, weil er sie zu spät begangen habe, erst nach den Unruhen zur Unabhängikeit. Erst nach der Tat lernt Haroun den berühmten Roman kennen, durch eine Frau, die seine Liebe zu ihr nicht erwidert. Auch hier keine Erfüllung. Doch eines begreift er: »Es ist ganz einfach: Diese Geschichte müsste neu geschrieben werden, in der gleichen Sprache, aber diesmal wie das Arabische von rechts nach links.« Gleichgültig und brutal steht Haroun den Verhältnissen gegenüber.
– Wie Meursault. Das Gericht verurteilt ihn, weil er seine Indifferenz nicht ablegt, weil er regungslos den Tod der Mutter akzeptiert, weil er gottlos ist. Die Schüsse auf den Araber spielen keine Rolle. Das ist irgendwie kafkaesk.
– Meursault ist nicht gottlos, er nähert sich ihm nur anders, genau wie Haroun. »Die Religion ist für mich wie öffentliche Verkehrsmittel, ich nehme sie nicht. Ich bewege mich gerne hin zu Gott, auch zu Fuß, wenn es sein muss, aber nicht in der organisierten Gruppenreise.« Die verordnete, die staatlich sanktionierte Religion verachtet er, ihre Rituale und Vorschriften sind ihm höchst suspekt. Das brachte Daoud eine Fatwa der Salafisten ein. Die Menschen in Algerien, in allen Maghrebstaaten, leben in einer haltlosen Gesellschaft auf der Kippe. Kolonie, Revolution, Islamismus. Die Verhältnisse schlagen um, aber ändern sich nicht. Die Menschen verlieren jede Illusion, jeden Halt. Das hat Folgen, die sich auch in Köln gezeigt hätten, so Daoud in einem Zeitungsartikel nach der Silvesternacht. Muslimische Länder leiden am »sexuellen Elend«, so seine These, und der Islam sei eine »Religion zum Tode«. Nicht alle haben ihm dafür applaudiert.
– Verstehe! Den politischen Entwicklungen in Nordafrika tritt Daoud mutig, kritisch und durchaus polemisch entgegen. Für einen Journalisten ein dankbares Feld, aber wie steht es um ihn als Literat? Hält sein Text Schritt mit dem großen »Urtext« von Camus? Der Ruhm und die Wirkkraft von Der Fremde gründet nicht zuletzt auf der Wucht der knappen, und eleganten Sprache, eine wie von der Sonne gebleichte und entwässerte Prosa. Eine Sprache, die zur Philosophie wurde.
– Lass es mich so sagen: Daoud nimmt als tapferer David den Kampf mit einem übermächtigen Goliath auf, folgerichtig kann er nicht alle seine Kiesel treffsicher plazieren. Bedingt durch die monologische Konstruktion, der vom Alkohol befeuerten Suada Harouns, lassen sich Wiederholungen nicht vermeiden, schleicht sich »arabische Weitschweifigkeit« ein, obwohl Daoud auf Französisch geschrieben hat, der Sprache des »Roumis«, des Fremden. Im Grunde genommen ist dies kein eigentlicher Roman, eher ein ins Fiktive hinübergreifender Essay. Hin und wieder mangelt es an Gestaltung, rutscht der Text ins Geschwätzige ab, verliert seine Form und stottert im Leerlauf vor sich hin. 200 Seiten können doch erstaunlich lang werden. Und dann blitzt vereinzelt wieder Finesse auf. Daoud liefert mehr als nur eine »Gegendarstellung«, die allein wäre ungenügend, er schreibt Camus fort, holt ihn aus dem Jahr 1942 in die Gegenwart, er hält Algerien und Frankreich einen Spiegel vor, in dem sich Ressentiments und Befindlichkeiten tausendfach brechen. Ein Buch für unsere Zeit, wahrscheinlich keines für die Ewigkeit. Was bleibt ist der Schatten, dieser lange Schatten, der Meursault, den Fremden, und mit ihm Haroun, sowie seinen Bruder Moussa ihrer scharfen Konturen beraubt. Dieser Schatten verschluckt uns bei Camus mit Haut und Haar, bei Daoud bleibt er blass.
Wie soll man eine solche Geschichte nennen, die einen riesengroßen, kabylischen Kellner mit breiten Schultern, einen anscheinend tuberkulösen Taubstummen, einen skeptischen, jungen Lehrbeauftragetne von der Uni an einen Tisch versammelt – zusammen mit einem alten Weintrinker, der keinen Beweis für das in Tasche hat, was er da anführt?
 Kamel Daoud: Der Fall Meursault
Kamel Daoud: Der Fall MeursaultEine Gegendarstellung
Aus dem Französischen von Claus Josten
Gebunden, 208 Seiten
Köln: Kiepenheuer & Witsch 2016
 Albert Camus: Der Fremde
Albert Camus: Der FremdeIn neuer Übersetzung von Uli Aumüller
Broschur, 160 Seiten
Reinbek: Rowohlt 2015 (71. Auflage)