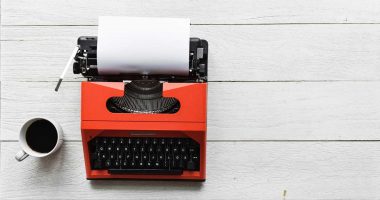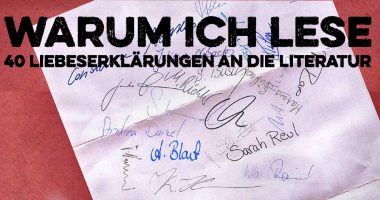Nochmals: Große Literatur – Eine Annäherung an objektive Kriterien
Was ist große Literatur? Antworten auf diese Frage haben vor geraumer Zeit einige Bloggerinnen und Blogger gesucht. Ausgangspunkt war eine beiläufige Bemerkung Uwe Kalkowskis (Kaffeehaussitzer) im Rahmen einer Diskussion über Eggers Der Circle auf Twitter. (Foto Kaffehaussitzer). Die daraufhin veröffentlichten Blogbeiträge näherten sich der »großen Literatur« individuell und überzeugten mit subjektiven Argumenten, es waren persönliche und (das unterstelle ich) ehrliche Aussagen, die dort in den Raum gestellt wurden. Exemplarisch genannt und zur erneuten Lektüre empfohlen seien: literaturen – Was ist eigentlich große Literatur | Kaffeehaussitzer – Die Gretchenfrage nach der Axt | Brasch & Buch – Ich bin zu klein für große Literatur | Bücherstadtkurier – Große, kleine, dicke, dünne Literatur – Und was ist Weltliteratur? | buchpost – Was ist ein Klassiker? (Ein Artikel der bereits vor der Diskussion geschrieben wurde.)
Übermütig habe ich damals eine Erweiterung der Frage in den Kreis der Disskutanten geworfen. Gibt es möglicherweise objektive, allgemeingültige Kriterien für große Literatur? Die Antwort, die ich bis heute schuldig geblieben bin, möchte ich heute geben, genauer gesagt, den Versuch einer Antwort. Denn meine Ausführungen sind notwendigerweise stichpunktartig und angesichts des weiten Feldes unvollständig.
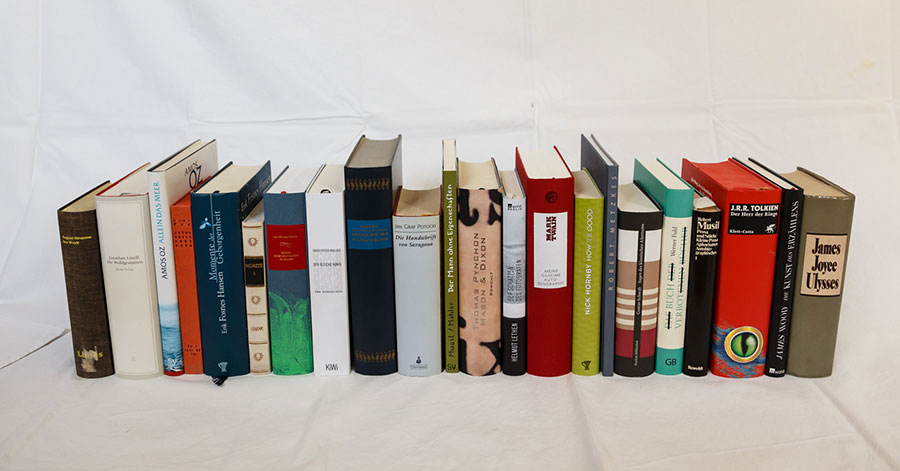
Im deskriptiven und normativen Vokabular der Literaturwissenschaft (als einer nach objektiven Kriterien suchenden und arbeitenden Disziplin (Voraussetzung)) wird der Begriff »große Literatur« nicht geführt. Wie schwammig und unpräzise der Begriff ist, zeigt sich allein im möglichen Antonym »kleine Literatur«. Gesetzt den Fall wir liessen das Begriffspaar dennoch passieren, dann wäre es zwingend nötig, sich auf einen verbindlichen Maßstab zu einigen, auf eine Art literarisches Urmeter. An dieser Aufgabe scheitert die Literaturwissenschaft, sie kennt wie alle Geisteswissenschaften (anders als die Physik und andere Naturwissenschaften) keine in der Natur gegebenen oder aus der Natur ableitbaren Normen und Gesetze.
Hier wird es theoretisch und kompliziert
Aber um Maßstäbe (zumindest um Kriterien) zur Wertung (im Sinne von Bewertung) von Literatur hat sich die Literaturwissenschaft durchaus bemüht und in eng gesteckten Grenzen sogar Einigungen erzielen können. Unterschieden werden können sprachliche Wertungen und motivationale Wertungen. Sprachliche Wertungen können offen (Dieser Roman ist ein Meisterwerk.) oder versteckt sein (Dieser Roman ist sehr umfangreich. (Das ist für jemanden, der eher kurze Texte bevorzugt, eine negative Wertung, für jemanden, der lieber lange Texte mag, eher eine positive Bewertung)) Zu den sprachlichen Wertungen soll dies (zunächst) genügen, denn in der Frage nach möglichen objektiven Kriterien für »große Literatur« sind motivationale Wertungen hilfreicher.
Motivationale Wertungen verfestigen sich meistens in der Auswahl von Texten. Das können bewusste Entscheidungen für ein bestimmtes Werk, einen bestimmten Autor oder ein bestimmtes Genre sein. Genauso kann die Selektion aber vor-bewusst erfolgen und auf (ausserliterarischen) Werten beruhen. Von gewissem Einfluss ist hier die Sozialisation des Lesers, die wiederum von subjektiven Komponenten (Erfahrungen, Dispositionen) oder intersubjektiven Komponenten (Konventionen, Normen) gesteuert wird. Im Idealfall bringt die Selektion (bewusst oder vor-bewusst) dem Leser zum einen spezifischen kognitiven und emotionalen Gewinn, der auf andere Weise nicht zu erzielen ist, zum anderen ermöglicht sie ihm Probehandlungen, also das Spiel mit Normen und (ausserliterarischen) Werten, ohne dabei Zwängen jeglicher Art zu unterliegen. Der kognitiv-emotionale Gewinn beruht (überwiegend) auf formal-ästhetischen Werten (Schönheit, Stimmigkeit, Offenheit), der inhaltlich-spielerische Gewinn fußt eher auf gesellschaftlichen und politischen Werten (Moralität, Freiheit, Humanität). Diese Wertmaßstäbe werden (bewusst und vorbewusst) in allen Bereichen, die sich mit Literatur beschäftigen, angelegt: in der Produktion (Autor), in der Distribution (Verlage, Buchandel, Bibliotheken) in der Rezeption (Leser) und der Interpretation (Kritik, Feuilleton).
Zwei weitere Typen von Werten sollen ins Feld geführt werden. Keine Panik, es sind die letzten beiden, bevor ich den Strapazen meiner Leser ein Ende setze. An die Literatur werden relationale und wirkungsbezogene Werte herangetragen. Relationale Maßstäbe bestimmen den Wert von Literatur in Hinsicht auf Bezugsgrößen wie natürliche Sprache, literarische Tradition oder auch die Realität. Von Interesse sind Übereinstimmungen und Abweichungen, Fragen von Originalität und Innovation. Texte von Wert überzeugen mit schöpferische Kraft (bezogen auf die Form) und mit Authentizität und Wirklichkeitsnähe (bezogen auf den Inhalt; wobei Wirklichkeitsnähe auch erzeugt werden kann, indem sich der Text absichtsvoll der Realität diametral entgegen stellt oder sich weit von ihr entfernt)). Die wirkungsbezogenen Maßstäbe beurteilen die tatsächliche (oder vermutete) Wirkung auf den Leser. Das können kognitive Effekte sein (Wissensvermittlung, Informationsgewinn) oder emotionale Effekte (Mitleid, Identifikation, Lust), lebenspraktische Wirkungen (Sinnstiftung, Handlungsanweisung) oder Effekte, die gesellschaftlich relevant sind (Zunahme an Prestige, Anerkennung, Statusgewinn).
Nicht verschwiegen werden soll, ohne es detailliert auszuführen: sowohl bei relationalen und wirkungsbezogenen Wertungen, als auch bei sprachlichen und motivationalen Wertungsmaßstäben ist entscheiden, welche Literaturtheorie bei der Betrachtung zugrunde gelegt wird, gleiches gilt für das gesellschaftliche Modell (Politik, Wertesystem, Wirtschaft, Soziales). Man sieht, viele Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um möglichst allgemeingültige Urteil fällen zu können.
Zurück zum Ausgangspunkt
Was hat das alles mit der Frage nach »großer Literatur« zu tun? Ersetzen wir »groß« durch »wertvoll« und legen dann die oben aufgedröselten Kriterien für »Wertung von Literatur« an, so ergibt sich folgendes (vereinfachtes) Bild. Je größer die Menge der individuellen Leser/Interpretatoren ist, die sich bei einem gegebenen Werk der Literatur nach sorgfältiger Überprüfung darauf einigen kann, hier möglichst viele oder alle Kriterien erfüllt zu sehen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei diesem Werk um ein wertvolles und bedeutendes handelt. Besteht dieser Konsens möglichst vieler Leser zusätzlich überzeitlich und kontextunabhängig, dann kann dies die Relevanz des Werkes zusätzlich steigern.
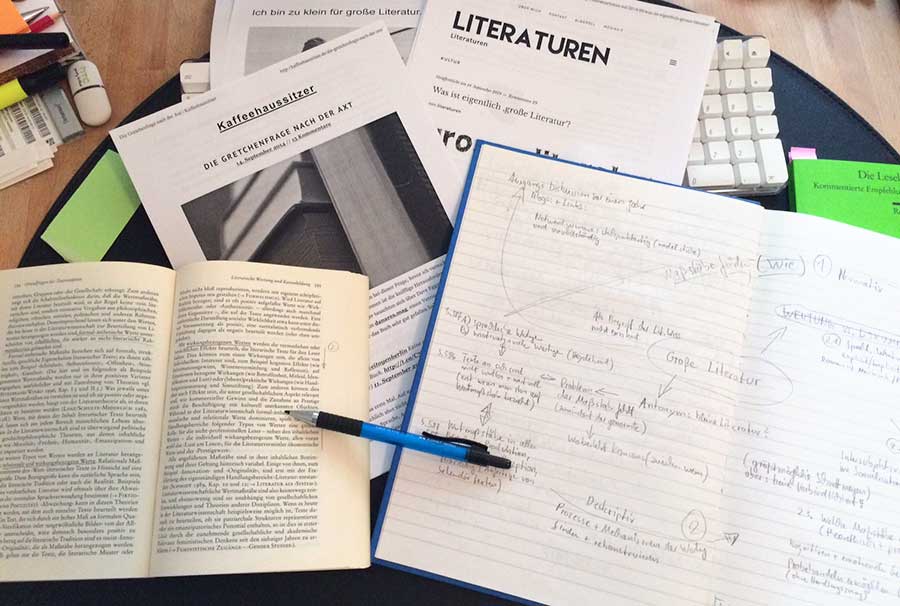
All das führt, aufmerksame Leser haben es längst geahnt, mitten hinein in das umstrittene Gebiet der Kanonbildung (Als Einstieg in die Problematik: Wikipedia – Kanon der Literatur). Ohne (auch) das weiter vertiefen zu wollen, soll an dieser Stelle nur festgehalten werden: Kanonbildung als Durchsetzung zeitloser literarischer Qualität nach eigenen Gesetzen gilt als überholt. Ein Kanon resultiert heute eher aus einer Reihe von Deutungs- und Selektionsprozessen, in denen literaturinterne und soziale Komponenten hinein- und zusammenspielen (siehe oben!). Problematisch bleibt, dass Kanones sich immer erst in zeitlichem Abstand herauskristallisieren. Die unmittelbare literarische Gegenwart bleibt meist aussen vor, weil deren Relevanz, Bedeutung und ja, auch »Größe« sich erst noch in der Bestätigung der Kriterien des Wertes in möglichst hoher Zahl durch möglichst viele Leser/Interpretatoren (überzeitlich und kontextunabhängig) erweisen muss.
Fazit – Karg und knapp
Hier schließt sich höchst überraschend der Kreis zu den eingangs erwähnten Blogbeiträgen, die sich vor 14 Monaten (vermeintlich) subjektiv und privatim dem Phänomen »große Literatur« angenähert haben. Denn zwischen den Zeilen läßt sich dort, als hätten wir es nicht längst geahnt, vieles von dem herauslesen, was ich hier referiert habe. (Das Referierte, wohlgemerkt, ist nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern basiert ausschließlich auf gelehrten Texten Anderer.) Ersetzen wir das kurze, aber unpräzise Wort von »großen Literatur« durch das genauere, aber monströse Wort von der »Literatur, die überzeitlich und kontextunabhängig, innerhalb gegebener Systeme in der Betrachtung möglichst vieler Individuen möglichst viele Kriterien zur Bewertung von Literatur positiv erfüllt«, käme das einer (nahezu) objektiven Beurteilung näher. Praktikabel im alltäglichen Gespräch wäre es aber nicht. Sollen und können wir also weiter leben mit dem Begriff »große Literatur«? Ich denke, einen Versuch wäre es wert.
Möge die geneigte Leserschaft nun entscheiden, ob dieser Versuch zu weiterführender Diskussion anregt oder, gesteht mir diese Koketterie am Ende zu, einfach nur in die Hose gegangen ist.