Kapitalismus macht kaputt – Michel Hoeullebecq, Ökonom
Frei nach dem berühmten Paradoxon des Epidemides darf postuliert werden: »Alle Ökonomen sind Scharlatane, sagt der Ökonom«. Bernard Maris’ Karriere verlief wahrlich paradox. Als führender Wirtschaftswissenschaftler saß er gleichzeitig im Aufsichtsrat der Banque de France, war kapitalismuskritischer Aktivist bei Attac und fiel nicht selten mit extrem linken Thesen aus dem normal-ökonomischen Rahmen. Unter dem Pseudonym Oncle Bernard verfasste er ausserdem regelmäßig Beiträge für das französische Satiremagazin Charlie Hebdo, zuletzt erschien dort Anfang Januar seine hymnische Besprechung zu Unterwerfung, dem jüngsten Roman seines Freundes Michel Houllebecq. Auf dem Cover prangte eine Karikatur des Schriftstellers.
Bernard Maris starb am 7. Januar bei dem terroristischen Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris. Das lenkte neue Aufmerksamkeit auf seinen Essay Michel Houellebecq, Ökonom. Eine Poetik am Ende des Kapitalismus, der bereits im Herbst 2014 erschienen war. Es ist müßig und auch ein wenig zynisch, darüber zu spekulieren, ob Maris’ Aufsatz ohne den Terror der Islamisten in Paris und dem damit verknüpften medialen Wirbel um Unterwerfung überhaupt in Deutschland erschienen wäre. Fakt ist, er liegt bei Dumont seit September 2015 in der Übersetzung von Bernd Wilczeck vor und kann oder sollte auch ohne permanente Rückgriffe auf den Pariser Anschlag gelesen werden.
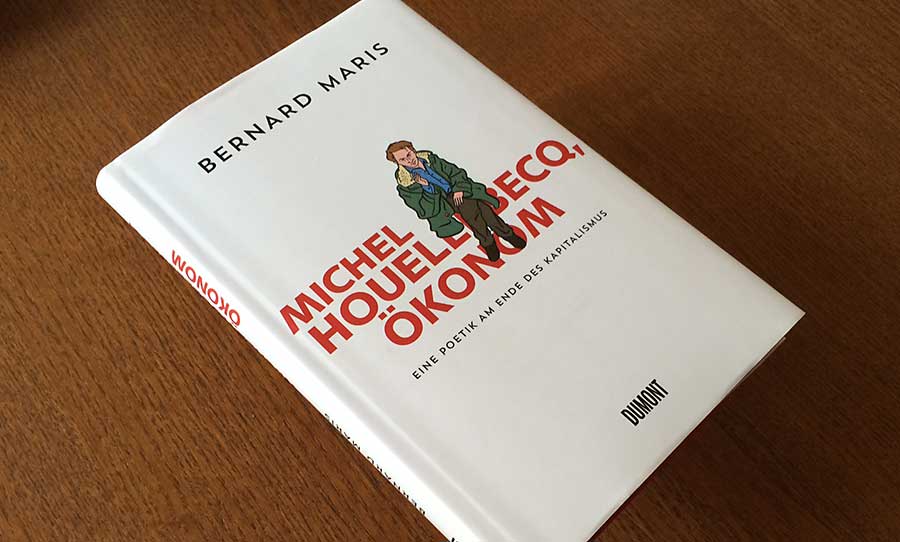
Maris geht von zwei Grundannahmen aus. Erstens sei die Ökonomie eine »Dismal Science«, die betrieben von Scharlatanen, nur »Hirngespinste und mit Gleichungen aufgeblasenes Geschwätz« und unbewiesenen Blödsinn von sich gibt. Zweitens sei Michel Houellebecq der »erste Schriftsteller, dem es gelungen ist, das ökonomische Unbehagen, das unser Zeitalter vergiftet, exakt zu erfassen«. So weit so gut.
Schumpeter, Marx, Fourier, Keynes, Marshall und Malthus, die Altvorderen der Ökonomie sind Maris’ Gewährsmänner (waren sie der Scharlatanerie noch nicht verdächtig?). Er referiert ihre wichtigsten Thesen und Ideen und sucht dann eifrig in Houellebeqcs Texten nach deren Spuren. Das Ergebnis lautet durchgehend und wenig überraschend: die zerstörerische Kraft des Kapitalismus ist es, die die Figuren der Romane kaputt macht. Sie leiden am System der Warenströme, am nimmermüde angekurbelten Konsum, am schwindenden Wert ihrer eigenen Produkte, die Welt ist ein Supermarkt und der Liberalismus schlägt das Individuum in Ketten.
Wie tödlich der Kapitalismus ist, verdeutliche Houellebecq vor allem dann, wenn seine Figuren an der Liebe scheitern. In ihrer Gier nach Geld und Anerkennung haben sie schlicht verlernt richtig zu lieben. Verstärkt wird dieses Phänomen durch das vergebliche Anrennen gegen das Alter und den Verfall. Houellebecq, so Maris, lege die wahre Funktionsweise des Kapitalismus offen mit all seinen Folgen von »krankhaftem Wettbewerb, freiwilliger Knechtschaft, Angst, Lust, Fortschritt Einsamkeit, Obsoleszenz«. Aus Wirtschaftsstatistiken, Unternehmensberichten, Arbeitslosenzahlen und Aktien-Indices liesse sich das nicht herauslesen, damit tarnten die Ökonomen lediglich die brutale Pranke des Kapitalismus, von deren tödlicher Kraft sie durchaus wissen. Ökonomen seien im eigenen System gefangen.
Wenn es eine Idee gibt, die alle meine Romane durchzieht, dann ist es die Idee von der absoluten Unumkehrbarkeit von Verfallsprozessen, wenn sie einmal begonnen haben.
(Houellebecq in einem Gespräch mit Bernrad-Henri Lévy)
Wenn Hoellebecqs Figuren einsam sind, sexuell zügellos, amoralisch, rücksichtslos egoistisch und obsessiv, dann sei das eben nicht, wie dem Schriftsteller oft vorgeworfen wird, bösartige Misanthropie oder bodenloser Kulturpessivismus, sondern konsequenter Ausdruck der Erbärmlichkeit der globalen, ökonomischen Zwänge. All das trägt Maris souverän und sicher vor. Allerdings drängt sich gleichzeitig der Eindruck auf, dass hier mitunter Ursache und Wirkung, beziehungsweise Krankheit und Symptom vertauscht werden. Houellebecqs Helden sind kaputte Typen, ja, aber eben doch viel mehr als nur Opfer (oder Täter) in einer ökonomisierten Welt. Über die Ökonomie an sich und ihre Mechanismen sagt das sowieso nichts.
Ich habe noch nie was von Wirtschaft verstanden.
(Michel in »Plattform«)
Allzu oft nimmt Maris die Romanfiguren zu wörtlich und schließt daraus direkt auf die Meinung des Autors. Ein fataler Fehler, der auch Maris eigentlich bekannt sein dürfte. Doch weil die These von der Poetik am Ende des Kapitalismus so schön ist, wird passend gemacht, was nicht passt. Diesen Kniff räumt zum Schluss seines Textes Maris selbst ein, wenn er sagt, dass »diesen kleinen Essay ein verschmitztes Lächeln durchzieht«.
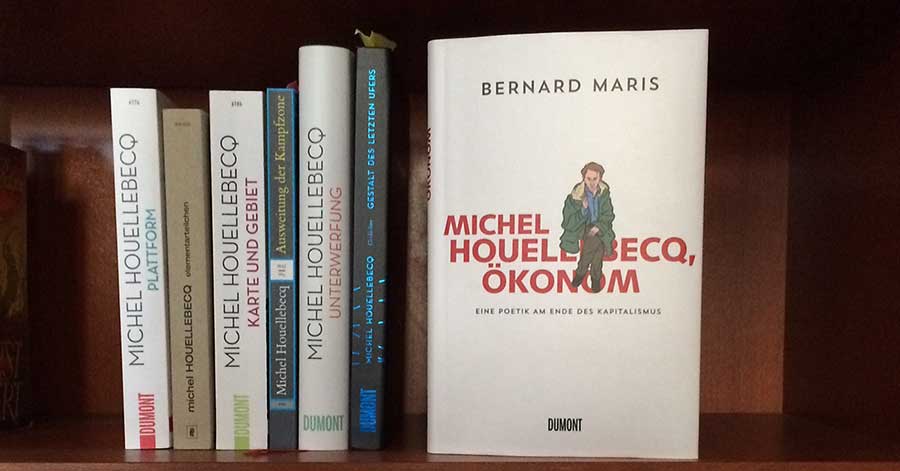
So entpuppt sich Maris’ Essay am Ende als zwar höchst amüsanter, aber leicht unbefriedigender Zwitter. Entgegen seinem Versprechen entlarvt er nämlich weder die Mechanismen des Kapitalismus, noch belegt er die Poetik Houellebecqs als umfassend kapitalismus-apokalyptisch. Auch den wasserdichten Beweis der Scharlatanerie in der eigenen Zunft bleibt er schuldig. Andererseits lesen sich die Thesen Maris’ locker weg und unterhalten durchaus auf hohem Niveau. Vor allem regen sie die Neugier an auf den ein oder anderen zitierten ökonomischen Basistext und, das ist vielleicht noch entscheidender, wecken sie frisches Interesse an Houellebecqs Romanen. Die zu lesen lohnt allemal, weit über ökonomische Interessen hinaus.
 Bernard Maris: Michel Houellebecq, Ökonom
Bernard Maris: Michel Houellebecq, ÖkonomEine Poetik am Ende des Kapitalismus
Aus dem Französischen von Bernd Wilczeck
Gebunden, 142 Seiten
Köln: Dumont Verlag 2015
Mehr zum Buch und eine Leseprobe sind zu finden bei dumont-buchverlag.de.


