Die Total-Arkadisierung des Harzvorlandes
Der Holzvulkan ist eine humoristische Parabel über Größenwahn und Vergänglichkeit. Hans Pleschinski erzählt die Geschichte von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel und seinem barocken Traumschloss Salzdahlum. Ein kleiner Fürst in einem kleinen Herzogtum will großen Vorbildern nacheifern, das Versailles Ludwig XIV. übertrumpfen, Rom, Paris und Amsterdam im verregneten Niedersachsen vereinen, pompöse Feste feiern, die selbst Europas absolutistischsten Herrscher vor Neid erblassen lassen. Nur Herzog Anton Ulrich soll genannt werden, wenn die Frage lautet: Wer hat die meisten Putten auf dem Dach?

Anton Ulrich war ein Träumer, Phantast und Größenwahnsinniger, aber auch Mann voller Willensstärke und Durchsetzungskraft und so ließ er sich nahe Wolfenbüttel Salzdahlum zimmern, ja, zimmern, denn für einen barocken Steinbau fehlte das Geld. Im Holzschloss trug er eine der größten Kunstsammlungen Deutschlands zusammen, die, obwohl nicht eben reich mit Stücken allererster Wahl gesegnet, mit ihrer schieren Masse auch heute noch zu beeindrucken vermag im leider mäßig besuchten Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig. Unterstützt von Gottfried Wilhelm Leibniz erweiterte Anton Ulrich, unter Einsatz nicht unbeträchtlicher finanzieller Mittel, die von seinem Vater gegründete und bis heute sehr bedeutende Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Obendrein hinterließ er als Dichter barocke Großromane, die über tausende Seiten mäandern und die Welt erklären und gab unzählige Opern (bei minderbegabten Komponisten) in Auftrag. Dem Palast Salzdahlum aus Harz-Fichten auf feuchter Wiese war zwar Ruhm aber kein Nachleben vergönnt, in Niedersachsens rauhem Klima verfaulte das Wolfenbüttelsche Versailles ebenso schnell wie es errichtet wurde; und mit dem Schloss alle barocken Gärten, das Labyrinth aus Brettern mit aufgemalten Hecken, die Tempelchen, das nach französischem Vorbild gestiftete Nonnenkloster, die mangels Wasserdruck nie sprudelnden Brunnen und, und, und. Von der einstigen Pracht kündet heute nichts mehr, Salzdahlum, diese »Titanic auf Land«, ist längst untergegangen, nur die leere feuchte Wiese ist noch da.
Diese feuchte Wiese ist der von Hans Pleschinski gewählte Schauplatz der Geschichte und erzählt wird hier, dank eines genialen Kniffes, Geschichte im doppelten Sinne. Ein Student der Germanistik aus dem sonnengleißenden Kalifornien reist durch Deutschland, um im strömenden Regen kurz vor Wolfenbüttel unvermittelt einen Bibliothekar zu treffen, der Anton Ulrichs untergegangenes Reich in der Erzählung wieder erstehen läßt. Zwischen Kühen, Weidezäunen und Pfützen spazieren, schreiten und tanzen die Beiden tropfnass durch das imaginäre Reich; der junge Student ist schnell angesteckt von den irrwitzigen Phantastereien Anton Ulrichs, die der Bibliothekar seitenlang zu zitieren weiß. Der junge Amerikaner wiederum erzählt die Nacherzählung nach; es ist ein langer Brief an seinen Freund in Berkeley, den wir lesen. Geschichtsschreibung ist immer Nacherzählung, ist immer geprägt von Perspektiven und Blickwinkeln, berichtete Historie ist immer Abhängig von der Gegenwart des Berichtenden. So purzeln gleichzeitig ganz unbarocke Stichworte wie D-Day, Nato und Grenze in den Text. Die erzählenden Figuren befinden sich im letzten Moment der Epoche von Deutscher Teilung und Kaltem Krieg. Dort, wo sie im Schatten des Brockens durch die versunkene Welt Salzdahlums tanzen, könnten ebenso Mittelstreckenraketen stationiert sein oder einschlagen. 1986, als Hans Pleschinski den Text verfasst und erstveröffentlicht hat, war das ein denkbares Szenario und in seinem Brief beschreibt der amerikanische Student Grenzzäune und -befestigungen, die Wunden in die Landschaft schlagen.
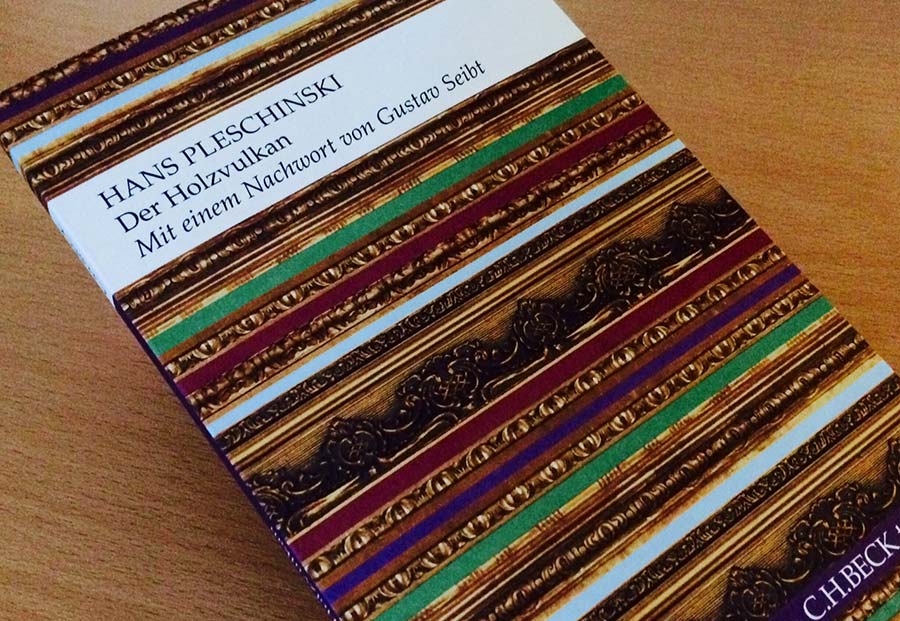
Heute, im Jahr 2014, da wir den 300. Todestag Anton Ulrichs begehen und den 25. Jahrestag des Mauerfalls, erhält Hans Pleschinskis Erzählung Der Holzvulkan in der Lektüre eine weitere aktuelle Bedutungsschicht. Deshalb hat er seinen wundervollen »Deutschen Festbrief« für die Reihe C.H. Beck textura durchgesehen und überarbeitet. (Das Büchlein, das als kleines Aperçu, ist ursprünglich im Haffmanns Verlag erschienen, dem, ähnlich Salzdahlum, eine Geschichte des kurzen Ruhms und des Untergangs anhaftet.) Doch das wichtigste ist: trotz aller möglichen geschichtsphilosophischen Volten, Pleschinskis Bericht vom selbsternannten Märchenkönig Anton Ulrich, der doch »nur« ein kleiner Herzog war, ist ein hinreißendes und humorvolles Kleinod. Die Geschichte eines Größenwahnsinnigen und die Erinnerung an eine andere, festliche, spendable und schönheitstrunkene deutsche Mentalität.
 Hans Pleschinski: Der Holzvulkan
Hans Pleschinski: Der HolzvulkanEin deutscher Festbrief
Mit einem Nachwort von Gustav Siebt
Klappenbroschur, 96 Seiten
München: C.H.Beck 2014


