Ein Roman ohne E
Top die Wette gilt – Mit diesen Worten wurde 1969 der Geburtsvorgang für ein großartiges, amüsantes literarisches Kuriosum eingeleitet. Der französische Schriftsteller George Perec hatte mit einem Freund gewettet, einen Roman ohne ein einziges e zu schreiben. Und er schaffte es. La Disparition dürfte damit einer der außergewöhnlichsten französischsprachigen Romanen sein. 1986 brachte der Verlag Zweitausendeins die deutsche Übersetzung von Eugen Helmlé unter dem Titel Anton Voyls Fortgang heraus. Original und Übersetzung lassen den Leser staunen, denn in beiden Sprachen, Deutsch und Französisch, ist das e der häufigste Buchstabe. Einen ganzen Roman hindurch auf ihn zu verzichten und dennoch verständlich zu bleiben, grenzt an ein Wunder. Lange vergriffen, liegt Anton Voyls Fortgang seit knapp einem Jahr in einer Neuausgabe wieder vor. Erst jetzt habe ich das bemerkt.
Der Übersetzer ist wirklich zu bewundern, denn jedermann wird beim Selbstversuch, auch nur einige Sätze ohne e zu schreiben, schnell scheitern. „Nimm fort ’nen Vokal und dicht‘ drauf los. Kaum zu schaffen ist das, nur Chaos im Hirn, schon nach’n paar Klicks auf Tastatur und Touchpad.“ Allein für diese blöden, sinnlosen Zeilen hab ich eine ganze Weile gebraucht. Meine Achtung für den Übersetzer Eugen Helmlé (und natürlich für den Autor George Perec) ist dabei von Wort zu Wort gestiegen. Hier einige Zeilen aus Anton Voyls Fortgang, um zu zeigen wie das Perec/Helmlé klingt:
Anton Voyl hat Schlaf nötig, doch Anton kommt nicht zum Schlaf und macht Licht. Auf Antons Uhr ist Null Uhr zwanzig. Anton ächzt laut, wälzt sich mal so rum und mal so rum – Antons Schlafcouch ist hart – stützt sich dann auf, griff sich’n Roman, schlug ihn auf und las; doch lang ging das nicht gut, da Anton vom Inhalt nichts, absolut nichts schnallt und ständig auf ’n Wort stößt, wovon ihm Sinn und Signifikation total unklar ist.
Soweit der erste Absatz aus Kapitel 1. Sicher, es ist nicht immer die geschmeidigste Sprache, die uns hier erwartet. Doch die erzwungene Kargheit und die sprachliche Enthaltsamkeit zwingen zu mehr Konzentration, den Autor vorab deutlich mehr als den Leser hinterher. Lipogramm oder auch Leipogramm nennt sich die Methode, derer sich Perec bedient hat. Über lipogrammatische Romane findet sich wenig in gängigen Lexika und Wörterbüchern. Bests Handbuch literrarischer Fachbegriffe definiert knapp: „Wortfolge, in der aus Gründen literarischer Spielerei ein bestimmter Buchstabe ausgespart bleibt.“ Dem französischen Larousse übrigens fällt zu Lipogrammen nur ein, daß sie etwas ausgesprochen Kindisches seien. Doch ich finde, Perecs Roman ist alles andere als kindisch. Er zeigt vielmehr, was mit Sprache möglich ist, wenn nicht mehr der Autor erzählt, sondern – durch das Korsett einer strengen Regel – die Sprache selbst.
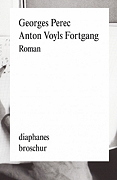 Georges Perec: Anton Voyls Fortgang
Georges Perec: Anton Voyls FortgangAus dem Französischen von Eugen Helmlé.
Mit einem Nachwort von E. Helmlé und R. Schock
Broschur, 416 Seiten
Zürich: diaphanes 2013
Ausgehend vom verfügbaren Wortmaterial hat sich die Geschichte, haben sich die Personen und die Handlung zu entwickeln. Das, was Anton Voyls Fortgang erzählt, schwankt zwischen Krimiparodie, Revolutionskomödie und einer Art Film-im-Film-Geschichte. Es gibt viele Rätsel, die auf Rätsel folgen und auch Gewalt und Terror schimmern hervor. Dieser Terror folgt einer linguistischen Methode, er entsteht durch Sprachmanipulation. Und so manifestiert und spiegelt sich das allmähliche, fast ausnahmslos grausame Verschwinden einer ganzen Sippe im Roman im verschwundenen Buchstaben.
Na klar, bei aller literaturtheoretischer und lingustischer Begeisterung, ist Anton Voyls Fortgang irgendwie auch eine Zumutung; niemand kann und wird das in einem Rutsch lesen. Gleichzeitig ist der Roman – und gleichberechtigt die kongeniale deutsche Übersetzung von Eugen Helmlé – ein Abenteuer, das in der Gegenwartsliteratur kaum seinesgleichen kennt. In einem sehr lesenswerten Nachwort übrigens beschreibt Helmlé, wie das ursprüngliche Sprachkorsett des Autors zur Zwangsjacke des Übersetzers mutiert.
Er kann nicht mehr die Sprache selbst erzählen lassen, denn dann wäre sein Text keine Übersetzung mehr … dabei hat der Übersetzer nicht nur einen Kiesel im Mund, sondern gleich einen ganzen Pflasterstein.
Auch wenn Aufmachung und Gestaltung des bei Diaphanes erschienenen Buches nicht so schön sind wie einst die des ziegelroten, fadengehefteten Leinenbandes bei Zweitausendeins, so sei dem Verlag doch unbedingt zu danken, daß er dieses wundervolle Sprachexperiment wieder greifbar gemacht hat. Unbedingt lesen und dann, vom e-Eleminierungsvirus befallen, alle Wörter und Texte in Reichweite auf ihre e-Haltigkeit überprüfen. Kurzfristig wird das zur Sucht, versprochen.
P.S.: Wer gerne den erwähnten schönen, roten Leinenband von Zweitausendeins möchte, wird bei ZVAB.com fündig. Kostet aber ein bißchen mehr.


