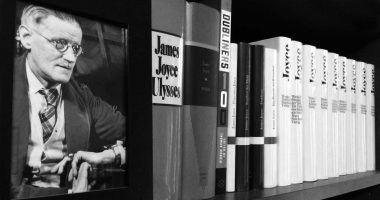»Fährmann, setz über!« – Nominierte Transportarbeiter im Gespräch
Übersetzer sind glückliche Menschen, denn jeder neue Auftrag öffnet und schenkt ihnen neue Welten. Das ist der segensreiche Ausgleich für oft mangelnde Entlohnung. So bringt es Klaus Binder auf den Punkt, der für »seinen Lukrez« als Übersetzer für den Preis der Leipziger Buchmesse 2015 nominiert ist. Als ebenbürtige Konkurentinnen und Konkurrenten laufen auf: Mirjam Pressler Judas (Amos Oz), Elisabeth Edl für Gräser der Nacht (Patrick Modiano), Moshe Kahn für Horcynus Orca (D’Arrigo) und Thomas Steinfeld für Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden (Selma Lagerlöf). Eine Woche vor der mit Spannung erwartetetn Preisverleihung haben sich die nominierten Übersetzer im Literarischen Colloqium Berlin vorgestellt.
Eine Herrenrunde ohne Damen
Leider waren Mirjam Pressler und Elisabeth Edl verhindert, so dass nur die nominierten Herren bei dem von Jürgen Jakob Becker moderierten Abend zu Wort kamen. Seit 10 Jahren wird der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben und von Anfang an wurden neben Belletristik und Sachbüchern auch Übersetzungen prämiert, eine wichtige Anerkennung. Übersetzer leisten unter vielen Opfern eine fleißige und mühsame Arbeit, die leider von vielen immer noch zu wenig gewürdigt wird. Auch die fünf Nominierten dieses Jahrgangs haben viel Lob und alle Preise verdient. Sie selbst bemühten sich allerdings im lockeren Plauderton, bescheiden ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. In der Reihenfolge ihres sympathischen Auftretens kommen zu Wort …
Klaus Binder übersetzt Lukrez: Über die Natur der Dinge

Schnell habe er sich vom Hexameter als sprachliche Spaßbremse verabschiedet, sagt Klaus Binder gleich zu Beginn. Ihm kam es darauf an, das eigentliche Anliegen Lukrez transparent und sinnlich erfahrbar zu machen, daher eine Übertragung in Prosa. Der römische Dichter schrieb für arme, orientierungslose Menschen in den Wirren der römischen Bürgerkriege, er stritt wider Aberglauben, Vorsehung und die Notwendigkeit von Göttern, wollte eine neue Sicht auf das Ganze liefern. Ein sensualistischer Marxist sei Lukrez gewesen, ein ganz moderner Denker, der heute als Gegengewicht zum Scientizismus tauge. Binder gibt freimütig zu, dass er nicht originär aus dem Lateinischen übersetzt, sondern auf bewährte englische Übersetzungen zurückgegriffen habe. Genau genommen habe er neben Lukrez auch dessen Rezeptionsgeschichte übersetzt, was wiederum geholfen habe, dem alten Text und dem, was Lukrez wollte, einen heutigen Ausdruck zu verleihen. Der lateinische Texte lag aber immer offen daneben und wurde ständig konsultiert. Möglich sei dies gewesen, weil Binder dem Lateinlehrer seines Sohnes eine Art Arbeitstipendium spendiert habe. Zwei Wochen lang wurde in einem gemeinsamen Urlaub am Morgen nach allen Regeln der Kunst Latein gepaukt und am Nachmittag ausgiebig über Lukrez diskutiert.
Seine Arbeit sieht Binder als die eines Transporteurs, nicht als die eines Fährmanns. Beim Übersetzen muss sich der Gegenstand wandeln, damit er am anderen, am fremden Ufer bestehen kann; getreu der Maxime Umberto Ecos, der sagt, eine Übersetzung ist nicht dasselbe, sondern quasi dasselbe. Ein Transporteur hebt und verändert den Gegenstand, passt ihn an, ohne ihn dabei zu kräftig zu verbiegen oder ihn gar zu zerstören. Die Zielsprache sei ihm beim Übersetzen immer wichtiger als die Ausgangssprache, sagt Klaus Binder. Wenn ich die Zielsprache nicht zum Maßstab der Dinge mache, bleiben sowohl das Original als auch die Neuformung am anderen Ufer Fremdkörper. Er habe deshalb, sagt Binder, so wörtlich wie möglich und so frei wie nötig Lukrez’ Gedanken »hinterhergeschrieben«, um den Text vom fernen lateinischen Ufer heil an unsere modernen deutschen Gestade zu bringen. Durch Binder hat der philosophisch anstrengende Argumentationsgang Lukrez’ seine Rhythmik und seinen sprachlichen Reichtum in der Transformation ins Deutsche wiedergewonnen. Das Lesen und besonders das laute Lesen wird plötzlich zum sprachlichen wie intellektuellen Vergnügen. Dank Klaus Binder ist Lukrez‘ Über die Natur der Dinge so modern, revolutionär und aktuell wie zu seinen Lebzeiten.
 Lukrez: Über die Natur der Dinge
Lukrez: Über die Natur der DingeIn deutsche Prosa übertragen und
kommentiert von Klaus Binder
Gebunden, 408 Seiten
Berlin: Galiani Verlag 2014
Ich verhehle nicht, dass Klaus Binder mein persönlicher Favorit für den Preis der Leipziger Buchmesse ist. Sein Lukrez ist eine sensationelle Wiederentdeckung eines beinahe vergessenen Textes.
Thomas Steinfeld übersetzt Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden

Nils Holgersson ist Steinfelds erste Arbeit als Übersetzer. Es war kein Auftrag, sondern ein Herzensanliegen, denn er habe mit diesem Buch vor vielen, vielen Jahren Schwedisch gelernt. Seine damalige Schwiegermutter in spe habe ihm das Buch hingelegt und gesagt, damit (und mit einem Wörterbuch) schaffst du es. Auf deutsch habe er den Nils nie gelesen, so Steinfeld, bis vor einigen Jahren. Da aber habe er bemerkt, dass mit allen verfügbaren deutschen Ausgaben irgendetwas nicht stimme, keine von ihnen sei der Nils Holgersson gewesen, den er kannte. Ähnlich ging es Christian Döring, dem Leiter der Anderen Bibliothek, auf dessen Vorschlag Steinfeld die Neuübersetzung schließlich in Angriff nahm. Hätte er geahnt, welche Mühen auf in Warten, er hätte das Angebot ausgeschlagen. Der Text ist aufgrund seiner Entstehungsgeschichte sehr schwierig und brüchig. Selma Lagerlöf schrieb das Buch im Auftrag der schwedischen Schulkommission als neues Unterrichtswerk zur Landesgeographie und Naturkunde. Sie brauchte mehrere Anläufe, tat sich schwer, brach ab, überarbeitete einzelne Passagen immer wieder und fand bis zum Schluss keinen durchgehenden Ton für das Werk. Doch gerade das mache den Nils Holgersson zu etwas besonderem, betont Steinfeld, der Lehrroman, sei mal sehr poetisch, dann wieder brüchig, es gebe Passagen in grausamen, holperigen Schwedisch, manche Abschnitte klängen wie in übelstem Amtsdeutsch verfasst.
Alle bisherigen Übersetzungen hätten das mißachtet und der Literaturnobelpreisträgerin Lagerlöf eine vermeindlich adäquate, hochpoetische deutsche Sprache »angedichtet«. Damit aber sei der ruppige, struppige und wechselhafte Geist des Buches zerstört worden. Thomas Steinfelds Übersetzung ist nicht nur die erste vollständige, sondern auch die bislang ehrlichste Übertragung ins Deutsche. Der wiederholte Wechsel in Ton, Klangfarbe und Rhythmus macht die Lektüre zum abwechslungsreichen Vergnügen und überdeckt gekonnt, dass es sich hier eigentlich »nur« um ein Schulbuch handelt. Explizites Lob zollte Steinfeld dem genialen Kunstgriff Lagerlöfs, dem weiten ausholdenden, schnellen Flug der Gänse mit dem Blick von oben auf das Land die Perspektive des winzigen Däumlings von unten entgegenzusetzen, die nur in kleinen, ruckeligen Bewegungen dicht am Boden haftend gewonnen wird. In Steinfelds Übersetzung ist Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden wieder ein wirkliches Abenteuer.
 Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden
Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons wunderbare Reise durch SchwedenAus dem Schwedischen übersetzt
und mit einem Nachwort versehen von Thomas Steinfeld
Gebunden, 708 Seiten
Berlin: Die Andere Bibliothek 2014
Ich verweise an dieser Stelle auch auf meinen längeren Beitrag über die Neuausgabe von Nils Holgersson.
Moshe Kahn übersetzt Stefano D’Arrigo; Horcynus Orca

Zu Beginn des Gespräches kramt Moshe Kahn in einer prall gefüllten Ledertasche und wuchtet sichtlich stolz sein Werk auf den Tisch. Ein Brocken von einem Buch, 1500 Seiten dick und knapp eineinhalb Kilo schwer. Doch die Seitenzahl sei nicht das Problem gewesen, schmunzelt Kahn, es sei die Sprache, die D’Arrigo in der 14 Jahre währenden Entstehung eigens für sein Meisterwerk der modernen italienischen Literatur entwickelt habe. Horcynus Orca, eine Art moderne Odyssee durch das südliche Italien am Ende des Zweiten Weltkrieges, ist verfasst in einem mit Hochitalienisch unterfütterten und unterschichteten sizilianischen Dialekt, also in einer komplett eigenständigen Sprache mit ungewöhnlichen Wortneuschöpfungen, grammatikalischen Kniffen und fremdartigen Satzkonstruktionen. In insgesamt achtjähriger Arbeit hat Moshe Kahn dafür den richtigen deutschen Ton gefunden und entwickelt. Fremd klingt das und doch vertraut, die Sätze haben eleganten Schwung und doch stolpert der Lesefluss immer wieder, weil die Bilder und Metaphern so exotisch und fremd sind. Laut lesen muss man das, sagt Moshe Kahn, er selbst habe viele Passagen ungezählte Male laut gelesen, um die Musikalität, den Rhythmus und die Klangfarben des Textes zu überprüfen. Weil die deutsche Sprache stark vom Vokal »e« dominiert ist, hat Kahn sehr viel Zeit investieren müssen, immer wieder Synonyme zu finden, um Sätze mit viel zu langen »e«-Ketten durch ein »u«, »o«, »ä« oder einen anderen Vokal oder Umlaut aufzubrechen. Bedenken, sich damit zu weit vom Original zu entfernen, hat Kahn mutig beiseite gefegt, denn schließlich habe D’Arrigo selbst ihm zu Beginn der Arbeit anvertraut, dass die Musikalität der Schlüssel zum Roman sei, nicht der konkrete Wortsinn.
Den Großteil seiner Übersetzungsarbeit hat Kahn übrigens in Marrakesch erledigt, mit Musik von Mahler im Hintergrund, in einem Haus am Meer; nicht wegen des Flairs, sondern aus finanzieller Not. Zwar habe er mit dem Verlag Teilzahlungen und Teillieferungen vereinbart, doch zum Überleben in Deutschland habe das trotzdem nicht ausgereicht, betont Kahn. Die Kaufkraft eines Euros sei in Marokko viermal so hoch wie daheim in Deutschland, deshalb das Arbeitsexil. Horcynus Orca galt als unübersetzbar, Moshe Kahn hat den Gegenbeweis angetreten, überaus erfolgreich. Leicht zu lesen ist der Roman wahrlich nicht und mit Sicherheit ist das Buch nicht jedermanns Kost, aber dank der Übersetzung ist es jetzt da und darf entdeckt werden. Moshe Kahn hat seine Übersetzertätigkeit mit diesem Buch gekrönt und beendet, künftig, so verriet er, möchte er sich Opernlibretti zuwenden und eine neue Form der textlichen und typografischen Darstellung finden. Duette, Terzette bis hin zu Oktetten sollen sich damit lesen lassen, wie sie klingen; ein interessantes Experiment. Viel Glück bei diesem Vorhaben, Moshe Kahn, und nochmals Danke für den Horcynus Orca.
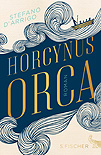 Stefano D’Arrigo: Horcynus Orca
Stefano D’Arrigo: Horcynus OrcaAus dem Italienischen
von Moshe Kahn
Gebunden, 1472 Seiten
Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2014
Die Bloggerpaten kommen zu Wort
Erstmals hat die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr auch Literatur- und Buchblogger ausgewählt, die als Paten eine der nominierten Persönlichkeiten und ihre Arbeit begleiten. Im folgenden sind die Paten der Übersetzer genannt und ihre Artikel verlinkt.
Bloggerpate Tilman von 54books über: Lukrez Die Natur der Dinge
Bloggerpatin Charlotte von besonders buch über: Selma Lagerlöf Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden
Bloggerpate Linus von Buzzaldrins Bücher über: Stefano D’Arrigo Horcynus Orca
Bloggerpate Arndt von Astrolibrium über: Amos Oz Judas
Bloggerpatin Jacqueline von Lesevergnügen über: Patrick Modiano Gräser der Nacht
Alle nominierten Bücher im Überblick